
Flaute in der Geldbörse: Bleibt die Inflation unsere Begleiterin?
Bremer Wirtschaftswissenschaftler Prof. Rudolf Hickel spricht über Ursachen und Folgen der Geldentwertung
Viele Menschen beschäftigt das aktuelle Inflationsgeschehen, das seit 2020 in Deutschland eine bislang unbekannte Dynamik mit Auf- und Abwärtsbewegungen entwickelt hat. Der renommierte Bremer Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Rudolf Hickel hält zum Thema einen Vortrag in der Stadtteilfiliale Neustadt der Sparkasse Bremen. Rudolf Hickel war langjähriger Professor für Politische Ökonomie und Finanzwissenschaft an der Universität Bremen sowie Gründungsdirektor vom Institut für Arbeit und Wirtschaft (iaw), dessen Forschungsleiter für Wirtschaft und Finanzen er bis heute ist. Im Interview mit SPOT erklärt er die Ursachen des Preisanstiegs und zeigt auf, warum die offizielle Inflationsrate nicht immer die persönliche Lebensrealität widerspiegelt.

SPOT: Wenn Sie den Verlauf des Inflationsgeschehens der jüngeren Vergangenheit in einem Bild beschreiben sollten – welches wäre es?
Prof. Dr. Rudolf Hickel: Die Inflation durchläuft seit 2020 ein zuvor nicht gekanntes Muster. Der Preis für die im Index der Verbraucherpreise zusammengefasste Kaufkraft gleicht einem Gipfelsturm, der allerdings durch den nachfolgenden Abstieg einigermaßen bewältigt worden ist. Von praktisch 0 Prozent in 2020 schoss dieser Verbrauchpreisindex auf den Spitzenwert von 6, 9 Prozent in 2023 und sank danach auf 2 Prozent in diesem Jahr. Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass die in diesem Jahr erreichte Zielinflationsrate mit 2 Prozent auch in den kommenden Jahren zu erwarten sein wird.
Ist damit das Gespenst der Inflation besiegt? Diese Frage provoziert all diejenigen, die die „gefühlte Inflation“ beschwören. Zwar sind die Energiepreise seit deren Explosion infolge des Krieges von Russland gegen die Ukraine und das dagegen gerichtete Gasembargo nach 2023 wieder abgeflacht. Aber bei wichtigen Lebensmitteln entsteht der Eindruck, wegen der gestiegenen Preise seien dies Luxusgüter. Überdurchschnittlich verteuerten sich im August gegenüber dem Vorjahresmonat Kaffee, Schokolade, und auch Obst. Allerdings musste deutlich weniger bei Kartoffeln und Zucker bezahlt werden. Dienstleistungen, vor allem Versicherungsleistungen dagegen sind gestiegen. Und wie ist eine solche unterschiedliche Preisentwicklung mit der Aussage, das Preisniveau steige nur noch um 2 Prozent zu vereinbaren?
Was wird mit dem Verbraucherpreisindex gemessen?
Der Verbrauchpreisindex ist nicht eine direkt messbare Größe. Vielmehr werden auf der Basis von Statistiken und Befragungen die Preisveränderungen erfasst. Von der Entwicklung der Preise für wichtige Nahrungsmittel wird auf die Veränderung der allgemeinen Inflationsrate (Verbraucherpreisindex) geschlossen. Dabei gilt die Butter als wichtigster Eckpreisartikel. Deren Preisveränderung verleitet zu dem Trugschluss: Ein hoher Butterpreis signalisiert teure Lebensmittelpreise und schließlich auch eine hohe Inflationsrate.
Ein immer wieder den aktuellen Konsumverhältnissen angepasster Warenkorb wird mit diesen Preisen von 2025 gegenüber 2024 bewertet. So besagt die im August ausgewiesene Veränderung des Indexes: Dieser Warenkorb kostet gegenüber dem August im Vorjahr 2,2 Prozent mehr. Hinter dieser gewichteten Zusammenfassung stecken Waren wie die Energie, die billiger geworden sind, ebenso wie teurer gewordene Lebensmittel. Dabei werden die erfassten Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mit 11,9 Prozent der gesamten Verbrauchsausgaben privater Haushalte im Warenkorb verrechnet. Der Unterschied zwischen stark verteuerten Waren bei einer niedrigen Inflationsrate mit 2 Prozent schürt das allerdings unberechtigte Misstrauen gegen den Verbraucherpreisindex.
Eine Ursache der Entwicklung ist eine über Energielieferungen importierte Inflation.
Welche Ursachen sehen Sie für die Inflation in den letzten Jahren?
Es gibt eine Fülle von Theorien, die die jüngste Inflationsentwicklung erklären. Klassischerweise wird behauptet, die Nachfrage sei größer als das Angebot und damit gäbe es Spielraum für Preiserhöhungen. Diese Erklärung trifft jedoch für die Inflationsbewegung der letzten Jahre kaum zu. Im Mittelpunkt steht eine über die Energielieferungen importierte Inflation. Übrigens hat Deutschland diese preistreibende Energiekrise einigermaßen gut bewältigt. Das zeigen die heute wieder sinkenden Energiepreise.

Die Inflation wird jedoch auch durch die Preissetzungsmacht von weltweit agierenden Unternehmen verursacht. Darauf hat unlängst der Internationale Währungsfonds hingewiesen. Einfluss auf die Inflation hat auch die Globalisierungskrise. Dadurch schrumpfen Preisvorteile für Deutschland. Darüber hinaus sind in der Anfangsphase des ökologischen Umbaus Preissteigerungen zu erwarten. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transformation werden jedoch die Preise sinken.
Inflation – kann man überhaupt etwas tun? Welche politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen halten Sie für besonders wirksam zur Stabilisierung?
Direkt zuständig für die Bekämpfung der Inflation ist die Notenbank, bei uns die Europäische Zentralbank. Sie hat geldpolitische Instrumente, mit denen auf die in der Gesamtwirtschaft verfügbare Menge an Geld und deren Preis Einfluss wird. Die Geldpolitik versucht dies über die Banken. Dabei steht der Zinssatz, den Geschäftsbanken für ihre kurzfristigen Einlagen bei der Zentralbank (EZB) erhalten beziehungsweise zahlen müssen, seit April 2024 im Mittelpunkt.
Die Rede ist vom Leitzins. Wenn Banken bei der Notenbank derzeit ihre Liquidität parken, erhalten sie einen Einlagenzinssatz von 2,00 Prozent. Die Erwartung ist, dass etwa bei der Erhöhung dieses Leitzinses für Fest- und Tagesgeld mehr an Zinsen an das Bankenpublikum bezahlt werden wird. Das klappt allerdings nicht immer. Auch muss die Notenbank neben der Inflationsvermeidung auch auf das wirtschaftliche Wachstum achten. Heute muss die Politik auf die immer noch im internationalen Vergleich zu hohen Energiepreise vor allem in der Industrie Einfluss nehmen.
Inflation ist ein ökonomisches, aber auch ein soziales Problem. Welche Gefahr sehen Sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Die Inflation führt in der Gesellschaft zu unterschiedlicher Betroffenheit. Wenn die Energie- oder Lebensmittelpreise steigen, dann belastet dieser Kaufkraftverlust Menschen mit niedrigem Einkommen vergleichsweise stärker als Vermögende. Zum Ausmaß der Unterschiede gibt es Untersuchungen. In der Hochphase der Inflation 2023 war die relative Last durch die Verbraucherpreise einer einkommensschwachen Familie mit zwei Kindern am größten. Deren Inflationsrate lag höher als der Gesamtwert. Darauf hat die Politik viel zu wenig reagiert. Der ausbezahlte Inflationsausgleich kam auch den Einkommensstarken zugute.
„Die Feinde der Demokratie nutzen die soziale Not für ihre Propaganda.“
Besonders relevant sind die sozial unterschiedlichen Auswirkungen bei Preissteigerungen im Zuge der ökologisch gewollten Transformation über CO₂-Abgaben. Deshalb ist ein sozialer Ausgleich durch ein Klimageld so wichtig. Leider ist trotz vieler Ankündigungen hier wenig passiert. Wenn die unterschiedlichen Belastungen der Inflation nicht sozial abgefedert werden, dann treibt dies die soziale Spaltung voran. Die Feinde der Demokratie nutzen die soziale Not für ihre Propaganda.

Ändert sich das Konsumverhalten unter dem Druck der Inflation?
Zweifellos, der jüngste Inflationsschock sowie die nach wie vor steigenden Preise für einige Lebensmittel haben zu einer Veränderung des Konsumverhaltens geführt. Die jüngste Umfrage von YouGov, eines international tätigen britischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut, belegt: 57 Prozent der Befragten haben ihre Einkaufsgewohnheiten wegen der hohen Preise verändert. Dazu gehört der Wechsel vom Supermarkt mit umfangreichem Sortiment zum Discounter, stärkere Beachtung von Sonderangeboten, weniger Lebensmittel werden weggeworfen und über das Ablaufdatum hinaus werden Produkte genutzt. Die negativen Folgen auch für die Wochenmärkte in Bremen, aber ebenso die Gesundheit sind unübersehbar.
Dazu kommt die positive Erkenntnis: Der jüngste Inflationsschock hat trotz der anfangs problematischen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank das Vertrauen in das Finanzsystem mit dem Kernbereich Banken kaum erschüttert. Im Gegenteil, Banken werden in dieser Krise als Stabilitätsfaktor anerkannt. Dagegen spricht auch nicht die Ausweitung der Kryptowährungen, die im Kern ohne Bezug auf ökonomische Wertschöpfung nur auf Spekulationen basieren.
Wenn wir auf die kommenden Jahre schauen: Wird die Inflation ein dauerhafter Begleiter bleiben?
Wir werden in den kommenden Jahren im Trend eher eine allerdings nicht eruptive, sondern leicht ansteigende Geldentwertung verzeichnen. Dazu tragen die Krise der Globalisierung aus deutscher Sicht, die Knappheit wichtiger Ressourcen, steigende Preise für Umweltbelastung etwa per CO₂-Abgabe, wachsende Unternehmensmacht und die weltweiten Krisen sowie die Verschiebung geopolitischer Machtansprüche bei. Die Geldpolitik kann zwar immer wieder die Inflation bremsen. Aber der Preis dafür darf nicht der Verlust an gesamtwirtschaftlicher Kraft und Arbeitsplätzen sein. Inflationsgefahren werden auch zukünftig im einer zukunftsfähigen Gesellschaft gebannt werden müssen.
Vortrag „Inflation – eine hartnäckige Herausforderung: Was tun?“
Der Vortragsabend mit Prof. Dr. Rudolf Hickel findet am Dienstag, 7. Oktober 2025, um 18.30 Uhr in der Stadtteilfiliale Neustadt der Sparkasse Bremen statt. Der Vortrag ist kostenlos. Da es begrenzte Plätze gibt, wird um Anmeldung gebeten.
Die Stadtteilfiliale Neustadt liegt in der Pappelstraße 100, 28199 Bremen.

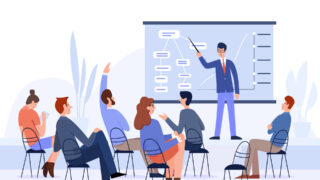


 und auf "Zum Homebildschirm hinzufügen" klicken.
und auf "Zum Homebildschirm hinzufügen" klicken.